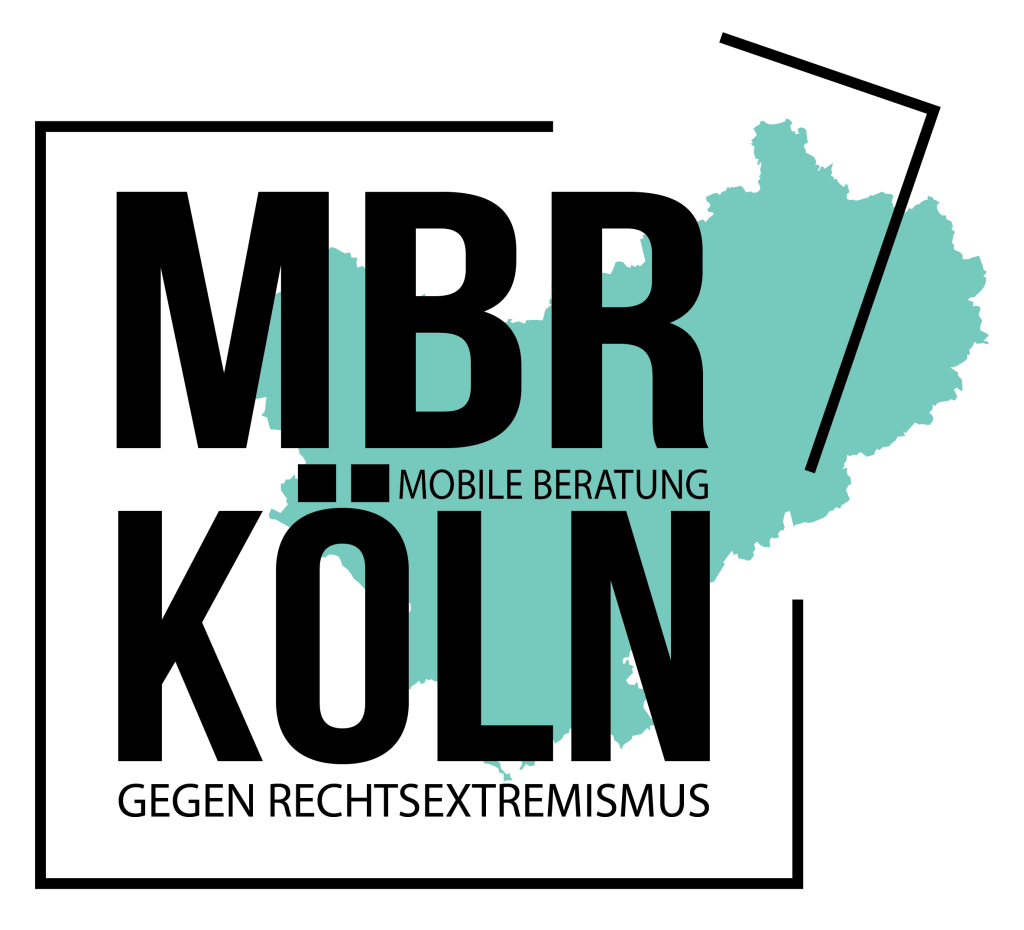7./8. September 2012
Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster
von Anna Herkenhoff, Michael Sturm und Heiko Klare
 „Überrascht hat uns nicht die Tatsache rechten Terrors, sondern vor allem, dass wir das so nicht haben kommen sehen“ machte Andrea Röpke, Fachjournalistin und langjährige Beobachterin der extrem rechten Szene in Deutschland, ihre Wahrnehmung der NSU-(Selbst-)Aufdeckung deutlich. Gemeinsam mit Dr. Stefan Dierbach, Bianca Klose, Hans-Peter Killguss und Dr. Mehmet Ata sowie knapp 50 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und Praxis diskutierte Röpke am 7. und 8. September 2012 über „Rechte Gewalt in Deutschland“. Im Rahmen der von IDA-NRW (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen), dem Geschichtsort Villa ten Hompel sowie der Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie (mobim) veranstalteten Tagung ging es zum einen darum, die Entwicklungslinien, Dimensionen und Ausprägungen Rechter Gewalt in Deutschland zu bilanzieren. Diese hat seit 1990 nicht nur weit über hundert Todesopfer gefordert, sie hat unter jenen, die in den Weltbildern der extremen Rechten zu Feinden erklärt werden, vielfach auch permanente Angst und Verunsicherung hervorgerufen. Diese Bedrohungsgefühle und oftmals auch realen Gewalterfahrungen haben bislang allerdings kaum gesellschaftliche, mediale und politische Aufmerksamkeit erfahren. Somit richtete sich der Fokus der Tagung in kritischer Perspektive auch auf die öffentlichen Wahrnehmungen von und die Diskurse über Rechte Gewalt in Deutschland.
„Überrascht hat uns nicht die Tatsache rechten Terrors, sondern vor allem, dass wir das so nicht haben kommen sehen“ machte Andrea Röpke, Fachjournalistin und langjährige Beobachterin der extrem rechten Szene in Deutschland, ihre Wahrnehmung der NSU-(Selbst-)Aufdeckung deutlich. Gemeinsam mit Dr. Stefan Dierbach, Bianca Klose, Hans-Peter Killguss und Dr. Mehmet Ata sowie knapp 50 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und Praxis diskutierte Röpke am 7. und 8. September 2012 über „Rechte Gewalt in Deutschland“. Im Rahmen der von IDA-NRW (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen), dem Geschichtsort Villa ten Hompel sowie der Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie (mobim) veranstalteten Tagung ging es zum einen darum, die Entwicklungslinien, Dimensionen und Ausprägungen Rechter Gewalt in Deutschland zu bilanzieren. Diese hat seit 1990 nicht nur weit über hundert Todesopfer gefordert, sie hat unter jenen, die in den Weltbildern der extremen Rechten zu Feinden erklärt werden, vielfach auch permanente Angst und Verunsicherung hervorgerufen. Diese Bedrohungsgefühle und oftmals auch realen Gewalterfahrungen haben bislang allerdings kaum gesellschaftliche, mediale und politische Aufmerksamkeit erfahren. Somit richtete sich der Fokus der Tagung in kritischer Perspektive auch auf die öffentlichen Wahrnehmungen von und die Diskurse über Rechte Gewalt in Deutschland.
„Der braune Kampf gegen das System“ – Rechte Gewalt und Rechtsterrorismus in Deutschland seit den 1970er Jahren
Rechte Gewalt in der Bundesrepublik ist alles andere als neu. Dieser Satz erscheint im Grunde banal, wie schon ein flüchtiger Blick auf die Geschichte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte deutlich macht. Dennoch reagierten Politik und Öffentlichkeit auf die zufällige Aufdeckung der vom NSU verübten rassistischen Morde im November 2011 äußerst überrascht. Zweifellos waren die Kaltblütigkeit und die Professionalität mit der Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und deren mutmaßliche UnterstützerInnen zwischen 1998 und 2011 agierten ebenso präzedenzlos wie das Versagen der Strafverfolgungsbehörden und Inlandsgeheimdienste. Dennoch entstand der NSU nicht voraussetzungslos gleichsam im „luftleeren Raum.“ Das Netzwerk konstituierte sich zum einen vor dem Hintergrund der rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda, Mannheim oder Rostock-Lichtenhagen am Beginn der 1990er Jahre. Bei diesen und zahlreichen weiteren Anlässen formierte sich ein Generation von RechtsextremistInnen, deren Selbstbewusstsein vor allem darauf gründete, dass ihre Auftreten, ihre Parolen, letztendlich auch ihre Gewalttaten, in nicht unerheblichen Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung zu stoßen schienen und zudem von den Behörden kaum sanktioniert wurden. Zum anderen fügte der NSU mit seinen Mordtaten der langen Geschichte des extrem gewalttätigen Neonazismus in Deutschland eine weitere traurige Facette hinzu. Den Entwicklungslinien Netzwerken und AkteurInnen extrem rechter Gewalt widmete sich Andrea Röpke in ihrem Vortrag.
Die Fachjournalistin, die seit Jahren investigativ in der extremen Rechten Deutschlands recherchiert, im März 2012 als Sachverständige vor dem NSU-Untersuchun gsausschuss des Bundestages gesprochen hat und zuletzt zusammen mit Andreas Speit das viel beachtete Buch „Mädelssache“ veröffentlichte, machte darauf aufmerksam, dass sich die Spuren militanter extrem rechter Strukturen bis in die frühen 1970er Jahre zurückverfolgen lassen. Zu dieser Zeit entstanden die ersten neonazistischen Aktions- und Wehrsportgruppen, die Anschläge und Gewalttaten verübten. So formierte sich neben der maßgeblich von Michael Kühnen ins Leben gerufenen Aktionsfront Nationaler Sozialisten, die stilistisch und habituell an die historische SA anzuknüpfen versuchte, die Wehrsportgruppe Hoffmann, aus deren Reihen nicht zuletzt der Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest in München im September 1980 verübt wurde, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen.
gsausschuss des Bundestages gesprochen hat und zuletzt zusammen mit Andreas Speit das viel beachtete Buch „Mädelssache“ veröffentlichte, machte darauf aufmerksam, dass sich die Spuren militanter extrem rechter Strukturen bis in die frühen 1970er Jahre zurückverfolgen lassen. Zu dieser Zeit entstanden die ersten neonazistischen Aktions- und Wehrsportgruppen, die Anschläge und Gewalttaten verübten. So formierte sich neben der maßgeblich von Michael Kühnen ins Leben gerufenen Aktionsfront Nationaler Sozialisten, die stilistisch und habituell an die historische SA anzuknüpfen versuchte, die Wehrsportgruppe Hoffmann, aus deren Reihen nicht zuletzt der Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest in München im September 1980 verübt wurde, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen.
Seit den frühen 1990er Jahren nahm extrem rechte Gewalt im nunmehr wiedervereinigten Deutschland neue Dimensionen an. Allein zwischen Januar 1990 und September 1991 kamen 12 Menschen durch Rechte Gewalt ums Leben. Dabei lagen deren Schauplätze, anders als es die oftmals klischeehaften Vorstellungen von „national befreiten Zonen“ in Ostdeutschland nahe legen, nicht nur in den „Neuen Bundesländern“. Rassistische Übergriffe ereigneten sich auch im Westen, wie die mörderischen Brandanschläge in Mölln (1992) und Solingen (1993) verdeutlichen. Daneben traten immer wieder auch militante, bisweilen auch international agierende Neonazinetzwerke in Erscheinung, wie Andrea Röpke am Beispiel des Blood & Honour-Netzwerkes illustrierte, dessen deutscher Sektion im Jahr 2000 durch das Bundesinnenministerium verboten wurde. In den Publikationen von Blood & Honour wurde (und wird) offen zum bewaffneten Kampf aufgerufen: „Man darf nicht vergessen, dass wir im Krieg sind mit diesem System und da gehen nun mal einige Bullen oder sonstige Feinde drauf.“
In Anbetracht der Kontinuität organisierter neonazistischer Militanz und von Teilen der Szene klar formulierter strategischer Ausrichtungen scheint der Umgang der Strafverfolgungsbehörden und Inlandsgeheimdienste mit den Strukturen und AkteurInnen Rechter Gewalt Röpke zufolge oft wenig nachvollziehbar. Zwar beschrieb das Bundesamt für Verfassungsschutz das Klima im militanten Neonazismus um die Jahrtausendwende als „hochexplosiv“ Jedoch wurde über Jahre hinweg beispielsweise in den von der Behörde publizierten Verfassungsschutzberichten oder anderen veröffentlichten Analysen, darauf verwiesen, dass keine handlungsfähigen terroristischen Strukturen und oder Konzepte für einen „bewaffneten Kampf“ erkennbar seien.
„Ich höre ja nicht auf, meine Schüler ernst zu nehmen, wenn sie über Politik reden…“ – Zur Wahrnehmung Rechter Gewalt als „Jugendgewalt“
Wie wird also extrem rechte Gewalt in Deutschland – nicht nur von Polizei und Geheimdiensten – wahrgenommen und verhandelt? Welche Erklärungsmuster und Analysen leiten sich aus diesen Wahrnehmungen ab? Diesen  Fragen ging der in Hamburg als Lehrer arbeitende Diplom-Pädagoge Dr. Stefan Dierbach in seinem Vortrag nach. Problematisiert wurde hierbei in erster Linie ein Diskurs in Medien und Gesellschaft, der rechte Gewalt als „Jugendgewalt“ beschreibt.
Fragen ging der in Hamburg als Lehrer arbeitende Diplom-Pädagoge Dr. Stefan Dierbach in seinem Vortrag nach. Problematisiert wurde hierbei in erster Linie ein Diskurs in Medien und Gesellschaft, der rechte Gewalt als „Jugendgewalt“ beschreibt.
Rechte Gewalt würde oft reflexhaft mit problematischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens junger Menschen verknüpft. Bei der Erklärung rechter Gewalttaten durch WissenschaftlerInnen treten oft psychosoziale Faktoren wie Gruppendynamik und -zugehörigkeit in den Vordergrund der Analyse und nicht der Tat zugrunde liegende Weltanschauungen und Menschenbilder oder gar historische Bezüge zum Nationalsozialismus. Mit einer Beschreibung des Phänomens rechter Gewalt als Strategie adoleszenter Problembewältigung gehe laut Dierbach aber eine De-Thematisierung der politischen Dimension der Taten einher, die einer adäquaten Ursachenanalyse neonazistischer Gewalt im Wege stehe. Gerade in der wissenschaftlichen Forschung zum Thema werde immer wieder die politische Motivation der TäterInnen bestritten und zudem die tatsächlichen Opfer analytisch überhaupt nicht mit einbezogen. Diese doppelte Verneinung der politischen Intention der TäterInnen durch die Fokussierung auf deren (angebliche) Jugendlichkeit sowie die Ausgrenzung des ideologischen Hintergrunds führt laut Dierbach zu einem „Credo der Entlastung“: Rechte Gewalt würde in dieser Sichtweise nur von Jugendlichen verübt, ist nicht politisch motiviert und hat auf keinen Fall etwas mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu tun.
Stefan Dierbach versteht unter „Rechten Gewalttätern“ aber vielmehr all jene, die andere gezielt zu Opfern machen, weil diese den Kriterien eines aktuellen und/oder historischen Feindbilds extrem rechter Ideologie entsprechen. Daher plädiert er grundsätzlich dafür, in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus „Jugend“ nicht als pauschalen Erklärungsfaktor für rechte Gewalttaten heranzuziehen. Jugendliche sollten vielmehr als politische Subjekte ernst genommen werden, die sehr wohl dazu in der Lage sind, aus einer politischen Motivation heraus zu handeln.
Eine eingehende Analyse rechter Gewalt, die die Ergebnisse von Einstellungsuntersuchungen und Jugendstudien einbezieht, würde Stefan Dierbach zufolge ganz andere Fragen aufwerfen, als sie in der von ihm beispielhaft dargestellten Forschung behandelt werden: Warum zum Beispiel begreift wer wen überhaupt als „fremd“? Was sagt das über das die Gesellschaft und deren Politikverständnis und Menschenbilder aus? Welche (politischen) Antworten können darauf gegeben werden? Und welche Widerstände gibt es, diese ernsthaft finden zu wollen?
„The Truth lies in Rostock“ – 20 Jahre später und keinen Schritt weiter?
Diese und ähnliche Fragen stellen sich auch nach der Beschäftigung mit dem britischen  Dokumentarfilm The Truth lies in Rostock (Die Wahrheit liegt/lügt in Rostock) aus dem Jahr 1993. Ein knappes Jahr nach dem Pogrom im Stadtteil Lichtenhagen hatten die Produzenten Mark Saunders und Siobhan Cleary versucht, zum einen die Ereignisse in und um das „Sonnenblumenhaus“ zwischen dem 22. und 26. August 1992 minutiös zu rekonstruieren, zum anderen die Frage nach Verantwortung, Aufarbeitung und Umgang mit den Opfern stellt. Auch die Vorgeschichte der Ausschreitungen wird in den Blick genommen: Die menschenunwürdigen Zustände unter denen Flüchtlinge in den Wochen und Monaten vor dem Pogrom in Rostock leben mussten. Die schon lange kursierenden Drohungen extrem rechter Gruppierungen, die bereitwillig von den lokalen Medien transportiert wurden und die bereits bestehende rassistische Stimmung in Rostock-Lichtenhagen weiter verstärkten. Nicht zuletzt die Rolle der örtlichen Polizei, deren Führungskräfte sich trotz des aufgeheizten Klimas unmittelbar vor dem 22. August ins Wochenende verabschiedeten.
Dokumentarfilm The Truth lies in Rostock (Die Wahrheit liegt/lügt in Rostock) aus dem Jahr 1993. Ein knappes Jahr nach dem Pogrom im Stadtteil Lichtenhagen hatten die Produzenten Mark Saunders und Siobhan Cleary versucht, zum einen die Ereignisse in und um das „Sonnenblumenhaus“ zwischen dem 22. und 26. August 1992 minutiös zu rekonstruieren, zum anderen die Frage nach Verantwortung, Aufarbeitung und Umgang mit den Opfern stellt. Auch die Vorgeschichte der Ausschreitungen wird in den Blick genommen: Die menschenunwürdigen Zustände unter denen Flüchtlinge in den Wochen und Monaten vor dem Pogrom in Rostock leben mussten. Die schon lange kursierenden Drohungen extrem rechter Gruppierungen, die bereitwillig von den lokalen Medien transportiert wurden und die bereits bestehende rassistische Stimmung in Rostock-Lichtenhagen weiter verstärkten. Nicht zuletzt die Rolle der örtlichen Polizei, deren Führungskräfte sich trotz des aufgeheizten Klimas unmittelbar vor dem 22. August ins Wochenende verabschiedeten.
In dem Film kommen zahlreiche der damals Beteiligten und Betroffenen zu Wort: Die verantwortlichen Landes- und KommunalpolitikerInnen, Polizeibeamte, Neonazis und AnwohnerInnen, die sich durch aktive Angriffe oder beifälliges Applaudieren an den Ausschreitungen beteiligten. Aber auch vietnamesische BewohnerInnen des Sonnenblumenhauses, die sich im letzten Moment aus dem brennenden Gebäude retten konnten und junge AntifaschistInnen, die sich mit den Betroffenen der rassistischen Ausschreitungen solidarisierten schildern eindrücklich ihre Wahrnehmungen und Erlebnisse.
Im Kontext der Fragestellungen der Tagung war der Film in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen verdeutlicht er, dass sich die Gewalt in Rostock weder spontan entlud noch durch Neonazis gesteuert wurde. Vielmehr zeigt er das Pogrom als Form einer rassistisch grundierten sozialen Praxis, an der zahlreiche AkteurInnen in sehr unterschiedlichen Rollen beteiligt waren – als aktiv Handelnde, als bystander oder als VertreterInnen der Staatsmacht, die den Mob gewähren ließ. Insofern knüpft sich an den Film auch die Frage nach den Umständen, Ausgangsbedingungen und gesellschaftlichen Ressentiments, die möglicherweise auch heute noch rassistische Gewaltexzesse hervorbringen könnten. Zum anderen stellt der Film The Truth lies in Rostock ein Element in den gegenwärtigen erinnerungskulturellen Auseinandersetzungen anlässlich des 20. Jahrestages der Ausschreitungen dar. Das Rostocker Stadtmagazin „Stadtgespräche“ legte den Film als DVD neu auf und verteilte kostenlos 10.000 Exemplare an Rostocker Haushalte. Ziel der Initiative ist es, jenseits ritueller Gedenkveranstaltungen und dem nach wie vor allgegenwärtigen „kommunikativen Beschweigen“ eine aktive kritische Auseinandersetzung innerhalb der Rostocker Bevölkerung mit dem damaligen Geschehen anzustoßen und darüber hinaus auf diesem Wege für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu werben (http://www.lichtenhagen-2012.de/).
Der Film und die anschließende Diskussion boten somit eine Überleitung zum zweiten Teil der Tagung, der sich dem Verhältnis von Rechter Gewalt und Zivilgesellschaft widmete. Im Zentrum stand hier die Frage, ob, in welchem Maße und unter welchen Voraussetzungen es der Zivilgesellschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelungen sei, die Handlungsräume der extremen Rechten einzuengen – wobei freilich von „der“ Zivilgesellschaft als kollektive Akteurin nicht gesprochen werden kann.
Rechte Gewalt, Staat und Zivilgesellschaft – Versagen und Verantwortung
Einen Einstieg in die Diskussion lieferte Bianca Klose, Projektleiterin der im Jahr 2001  gegründeten Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin (mbr) sowie Geschäftsführerin des Vereins für Demokratische Kultur Berlin e.V. Auf Grundlage der Erfahrungen der mbr thematisierte sie kritisch die vielschichtigen, oftmals widersprüchlichen, nicht selten konfliktträchtigen Beziehungsgeflechte zwischen mit öffentlichen Geldern geförderten Beratungseinrichtungen zur Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements, dem Staat mit seinen Behörden sowie seinen Steuerungs- und Kontrollansprüchen und den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die bisweilen gleichzeitig als AdressatInnen staatlicher Zuwendung und Repression firmieren.
gegründeten Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin (mbr) sowie Geschäftsführerin des Vereins für Demokratische Kultur Berlin e.V. Auf Grundlage der Erfahrungen der mbr thematisierte sie kritisch die vielschichtigen, oftmals widersprüchlichen, nicht selten konfliktträchtigen Beziehungsgeflechte zwischen mit öffentlichen Geldern geförderten Beratungseinrichtungen zur Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements, dem Staat mit seinen Behörden sowie seinen Steuerungs- und Kontrollansprüchen und den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die bisweilen gleichzeitig als AdressatInnen staatlicher Zuwendung und Repression firmieren.
Ausgangspunkt von Bianca Kloses Überlegungen war die Feststellung, dass die extrem rechte Gewaltwelle am Beginn der 1990er Jahre vom Niedergang der emanzipatorischen Neuen Sozialen Bewegungen (Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Stadtteilgruppen etc.) flankiert worden sei, die vor allem in der „alten“ Bundesrepublik während der 1970er und 1980er Jahre das gesellschaftliche Klima und die politische Kultur mit geprägt und verändert hatten. Nach der Wiedervereinigung gelang es zudem extrem rechten Gruppen, sich in ländlich geprägten Regionen mit nur schwach ausgeprägten zivilgesellschaftlichen Strukturen zu etablieren. Diese Entwicklung wurde in Ostdeutschland besonders augenfällig, war aber auch in den „alten“ Bundesländern zu beobachten. Ein Ergebnis dieses Befundes war schließlich die Einrichtung staatlich geförderter Mobiler Beratungsteams seit 2001 zunächst in den Neuen Bundesländern und in Berlin, deren Aufgabe darin besteht, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus zu unterstützen und perspektivisch demokratisches Bewusstsein zu stärken.
Die Arbeit der Mobilen Beratung hat sich durchaus als erfolgreich erwiesen. So hob Bianca Klose die hohe fachliche Kompetenz, die enge regionale Vernetzung, aber auch die schnelle, wahrnehmbare Interventionsfähigkeit der Mobilen Beratung in öffentlichen Debatten über den Rechtsextremismus in Deutschland hervor. Gleichzeitig erweist sich dieser Expertenstatus jedoch als problematisch. Die eigentlich notwendige gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rechter Gewalt und extrem rechten Dominanzbestrebungen wird demnach allzu oft an die professionellen MitarbeiterInnen der Mobilen Beratung delegiert. Deren erklärtes Ziel, die Zivilgesellschaft für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus zu aktivieren, wird somit allerdings verfehlt. Insofern erscheint es kaum verwunderlich, dass das Bekanntwerden der Verbrechen des NSU-Netzwerks kaum gesellschaftliche Resonanzen hervorgerufen hat. Größere Demonstrationen, Kundgebungen oder Lichterketten, die noch am Beginn der 1990er Jahre die Reaktionen auf die rassistischen Übergriffe und Brandanschläge geprägt hatten, blieben nun weitgehend aus. Der NSU beschäftigt heute vor allem parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Staatsanwaltschaften, FachjournalistInnen und andere Rechtsextremismus-„ExpertInnen“, zu denen auch die MitarbeiterInnen der Mobilen Beratung zählen.
Nicht zu Unrecht sprechen KritikerInnen daher nicht nur in diesem Zusammenhang von einer „Verstaatlichung“ der Zivilgesellschaft. Gleichwohl sehen sich Beratungseinrichtungen und zivilgesellschaftliche Initiativen mit staatlicher Gängelung konfrontiert. Deutlichstes Beispiel hierfür ist die stark kritisierten „Extremismusklausel“, mit der die durch das Bundesfamilienministerium geförderten Beratungseinrichtungen zwingend verpflichtet werden, ihre KooperationspartnerInnen auf ihre Verfassungstreue hin zu überprüfen. Die Situation erscheint paradox, besteht doch offenbar ein großes staatliches Misstrauen gegenüber der „Zivilgesellschaft“ und ihren AkteurInnen, die in ihrem Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus eigentlich gefördert werden sollen. Bianca Klose warf daher die Frage auf, ob und in welchem Maße „die Behörden in Deutschland für eine kritische Zivilgesellschaft“ überhaupt bereit seien.
Ein Jahr nach NSU-Aufdeckung und 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen: „Das Schweigen im Lande“
Was hat sich verändert im Hinblick auf den Umgang mit den rechten Gewalttaten von  Rostock-Lichtenhagen vor 20 Jahren und mit den rassistischen Morden durch den NSU? Gibt es Unterschiede (oder gar Fortschritte) in der Art der öffentlichen Thematisierung und Aufarbeitung der Ereignisse? (Wie) Reflektiert die Gesellschaft ihre Rolle im Zusammenhang mit den Gewalttaten der Neonazis, wie positioniert sie sich? Dies waren die Ausgangsfragen in einer Podiumsdiskussion mit Dr. Mehmet Ata, als freier Journalist unter anderem tätig für den Kölner Express und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Bianca Klose und Stefan Dierbach.
Rostock-Lichtenhagen vor 20 Jahren und mit den rassistischen Morden durch den NSU? Gibt es Unterschiede (oder gar Fortschritte) in der Art der öffentlichen Thematisierung und Aufarbeitung der Ereignisse? (Wie) Reflektiert die Gesellschaft ihre Rolle im Zusammenhang mit den Gewalttaten der Neonazis, wie positioniert sie sich? Dies waren die Ausgangsfragen in einer Podiumsdiskussion mit Dr. Mehmet Ata, als freier Journalist unter anderem tätig für den Kölner Express und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Bianca Klose und Stefan Dierbach.
Die Rolle der Medien im Zusammenhang mit den Gewalttaten der Neonazis des NSU stellt Mehmet Ata als äußert kritikwürdig dar. Diffamierende Begriffe wie „Dönermorde“ wurde durch die Presse, aber auch durch zivilgesellschaftliche Akteure, im Zusammenhang mit den rassistisch motivierten Taten unhinterfragt übernommen. Der politische Hintergrund der Taten wurde jahrelang nicht gesehen, weder von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten noch von Presse oder Zivilgesellschaft. Opfer und Betroffene, die beispielsweise nach dem Nagelbombenanschlag in Köln 2004 auf ein rassistisches Motiv hinwiesen, wurden nicht ernst genommen. Beunruhigend ist in diesem Zusammenhang, dass diese Art von Ignoranz von den Betroffenen nicht einmal mehr als besonders bemerkenswert wahrgenommen wird – sie reihe sich Mehmet Ata zufolge schlichtweg ein in die im Umgang mit deutschen Behörden erfahrenen gesellschaftlichen Ausgrenzungen und Diskriminierungen.
Im Anschluss an die Thesen von Bianca Klose stellte sich im Verlauf der Diskussion die Frage, in wieweit die Gesellschaft selbst überhaupt bereit ist für eine ernsthaft kritische Auseinandersetzung mit der extremen Rechten – und damit auch mit sich selbst. Der Fokus wird in Debatten um Rassismus gern auf „die Nazis“ oder „die Rechten“ (in diesem Fall z.B. auf den Terrorismus des NSU) gerichtet. Die DiskutantInnen waren sich einig, dass diese Eingrenzung aber den Blick auf die latenten Rassismen, die die deutsche Gesellschaft durchziehen. und die extrem rechte Thesen und Erklärungsmuster überhaupt erst anschlussfähig machen, verstelle.
Auch die reflexhaft geführte Debatte um ein Verbot der NPD sei laut Bianca Klose in diesem Zusammenhang wenig förderlich. Sie führe dazu, sich aus deutlicher Distanz einmal mehr mit dem vermeintlichen Randphänomen „Rechtsextremismus“ auseinanderzusetzen, während die Teile der Gesellschaft, die sich in Abgrenzung dazu in der „Mitte“ verorten, die eigenen rassistischen Ressentiments nicht thematisieren müssen.
Stattdessen, so Stefan Dierbach, müsse die Frage aber – auch um den von ihm konstatierten „Entlastungstendenzen“ entgegenzuwirken – lauten: Wo sind extrem rechte Positionen deckungsgleich mit denen weiter Teile der Gesellschaft? Die Abgrenzung „der Mitte“ gegen „die Nazis“ solle überwunden werden, da deren Denken und Handeln als Symptom eines gesamtgesellschaftlichen Problems begriffen werden muss, zu dessen Lösung schließlich die Auseinandersetzung mit den politischen Positionen und gesellschaftlichen Realitäten der vermeintlichen Mitte notwendig sei.
Richtiger Ansatz, aber falscher Fokus? Worüber noch zu sprechen ist…
Die Frage nach der Verantwortung der „Mitte der Gesellschaft“ griff auch Hans-Peter  Kilguss von der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln in seiner Tagungsreflexion auf. In diesem Kontext stellte er zur Diskussion, ob nicht mit dem Fokussierung auf „Rechte Gewalt“ eine irreführende Rahmung des Problems stattgefunden habe. Dennoch mahnte Hans-Peter Killguss analytische Präzisierungen an. Dies betreffe zum einen ganz grundsätzlich die Definition des Terminus „Rechte Gewalt“. Zum anderen aber auch den Topos von der „Mitte der Gesellschaft“. So sei der Hinweis auf die weite Verbreitung ausgrenzender und rassistischer Haltungen zwar richtig und wichtig, gleichwohl gelte es, die Zusammenhänge zwischen medial, politisch oder gesellschaftlich produzierten Trennlinien und den jeweils konkreten Ausgrenzungs- und Diskriminierungspraktiken genau auszuleuchten.
Kilguss von der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln in seiner Tagungsreflexion auf. In diesem Kontext stellte er zur Diskussion, ob nicht mit dem Fokussierung auf „Rechte Gewalt“ eine irreführende Rahmung des Problems stattgefunden habe. Dennoch mahnte Hans-Peter Killguss analytische Präzisierungen an. Dies betreffe zum einen ganz grundsätzlich die Definition des Terminus „Rechte Gewalt“. Zum anderen aber auch den Topos von der „Mitte der Gesellschaft“. So sei der Hinweis auf die weite Verbreitung ausgrenzender und rassistischer Haltungen zwar richtig und wichtig, gleichwohl gelte es, die Zusammenhänge zwischen medial, politisch oder gesellschaftlich produzierten Trennlinien und den jeweils konkreten Ausgrenzungs- und Diskriminierungspraktiken genau auszuleuchten.
In den Blick zu nehmen sind daher die gesellschaftlichen Kräftefelder, die Resonanzräume für Rechte Gewalt ermöglichen, diese aber auch begrenzen können. Die kritische Betrachtung der „Mitte der Gesellschaft“ darf somit die AkteurInnen Rechter Gewalt nicht außer Acht lassen. Unter welchen Bedingungen formieren und reproduzieren sich etwa neonazistische Kernmilieus, aus denen wiederum die ProtagonistInnen des NSU hervorgegangen sind? Zu konkretisieren sind aber auch die Diskussionen um zivilgesellschaftliche Gegenstrategien und Handlungsoptionen. Die VeranstalterInnen werden diese Fragen(n) im kommenden Jahr vertiefen und sich im Rahmen einer Tagung mit ihnen auseinandersetzen. Die Inhalte der Tagung „Rechte Gewalt in Deutschland. Dimensionen – Wahrnehmungen – Diskurse“ werden zudem ausführlich im „Überblick 4/2012“, der Vierteljahreszeitschrift von IDA NRW, dokumentiert und kommentiert.